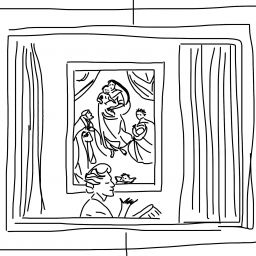Man hätte es ahnen können: Schon vor den ersten Tönen standen zwei allegorische Figuren an der Rampe, eine schneeweiße Frau und ein kohleschwarzer Mann. Madonna und Inka, Unschuld und Unheil? Gut und böse, heiß und kalt? Nein: Schwarz und weiß, mehr nicht. Stehen. An der Rampe. Das war Programm.

Die ersten Töne dann? Nicht die Ouvertüre. Die kam erst später. Verdi geschüttelt, aber kaum wirklich anrührend. Damit wäre das Fazit dieser Premiere an der Semperoper schon mal vorweggenommen. Ging ja ohnehin alles durcheinander hier, etwas Petersburger Urfassung, dazu die Mailänder Überarbeitung. Schicksal halt?
»La forza del destino« ist von Schicksalsfragen geradezu durchdrungen. Einen Ausweg gibt es nicht. Dabei hat Giuseppe Verdi seinen Protagonisten so viele Möglichkeiten eröffnet, der »Macht des Schicksals« zu entkommen. Archaisches Rachedenken aber, Blut- und Hoden-Ideologie wirkte damals noch stärker. Und heute? Darüber hat sich Regisseur Keith Warner keine Gedanken gemacht. Seine jüngste Dresden-Produktion kommt ganz ohne Sinn und tiefere Bedeutung aus, aber immerhin mit kräftigem Schwarz-Weiß. Als hätte er darauf gesetzt und gehofft: Die Musik wird’s schon richten.

Das tat sie allerdings auch. Unter der musikalischen Leitung von Mark Wigglesworth spielte die Staatskapelle großmächtig auf, mitunter zum Leidwesen von Textverständlicheit und Gesang. Letzterer aber war durchweg so hörenswert, dass man die überwiegend konservative, teils auch klamottige Regie von Keith Warner glatt hätte übersehen können. Über-sehen, wenn man nur noch ein Auge zugedrückt hätte. Um in Verdis Klangwelten zu schwelgen, seine hier durchaus vorhandenen Leitmotive auf sich wirken zu lassen und sich bestenfalls vorzustellen, wie das bildmächtig hätte umgesetzt werden können.
Grundlagen dafür boten Orchester und Staatsopernchor einschließlich Extrachor, von Jörn Hinnerk Andresen in gewohnter Weise bestens einstudiert. Wigglesworth ließ es uneitel zu, dass die Verdi-Ouvertüre erst nach der ersten Szenenfolge erklang. Warner wollte mit dieser Drehung vermutlich Impulse setzen: schließlich ist diese Oper ein Krimi, in dem es um überkommenes Prinzipiendenken geht, das ebenso vorgestrig wie rituell religiös ist.
Apropos, sowohl die Titelseite des Programmheftes als auch das Eingangsmotiv der Oper – und dann auch noch viele weitere Szenen der gut dreieinhalbstündigen Oper – wirken wie eine Annexion der vom aktuellen Bayern-Fürsten für seine Glaubensgemeinschaft in Anspruch genommenen Symbolik. Dabei ist das vermeintlich heilige Kreuz doch schon wesentlich älter als sämtliche Bibel-Legenden und wurde von der Christenheit nur schein-heilig okkupiert.

Bei Keith Warner gehört das Kreuz jedenfalls zu den Grundfesten der Szene (bei Markus Söder zu den „Grundfesten des Staates“, des bayerischen Freistaates wohlgemerkt). Es wäre müßig, lange auf diese zumeist hölzernen Balkensymbole einzugehen. Müßig auch, die statuarische Regie analysieren zu wollen. Aufgelockert wird sie nur durch nochmals albernere Kampfchoreografien. Spätestens hier steht die Regie ganz im Schatten der Musik – und stört sie sogar sehr geräuschvoll.
Was aber die über ein Spektrum von leidenschaftlich devot bis selbstbewusst impulsiv singende Emily Magee als reife Donna Leonora vokal aufzufahren versteht, was der Tenor Gregory Kunde als ihr Geliebter Don Alvaro dem mit Schmelz und Schärfe entgegenzusetzen hat, was Alexey Markov als rächend gerächter Bruder mit Kraft und Donner aufzubieten weiß, das allein schon ist die pure Hingabe wert. Ein großes Opern- und ein noch größeres Stimmfest. Bei dem nur die Augen-Blicke zu kurz kommen, die sehenswert sind.
Zum musikalisch gelungenen Reigen, das als wahres Sängerfest heftig bejubelt worden ist, (obwohl durchkomponiert, immer wieder auch mit Szenenapplaus) zählen unbedingt Christina Bock als Preziosillla und Curra mit sowohl stimmlich als auch spielerisch zigeunerhafter Carmen-Kraft sowie Pietro Spagnoli, der einen großartigen Fra Melitone abgab. Stephen Milling im Doppelpart als Leonoras Vater und Padre Guardino glänzte mit Noblesse in Spiel und Gesang.
Schon in der Eingangsszene erwies sich das Bühnenbild von Julia Müer zwar als ebenso variabel wie knarzend, wirkte in der Folge jedoch beliebig und austauschbar. Von der schwarz-weißen Schicksalskreuzung bis hin zu den Schlachtfeldern des Schicksals gab es die Grundlage ab für eine klischeehafte Personenführung, in der die Schattenseiten von Kriegsverherrlichung und mönchischer Bigotterie eher zum Kopfschütteln taugten.