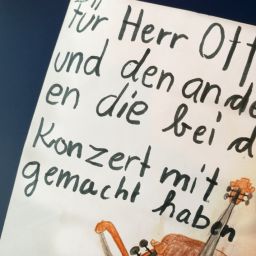Ein Sinfonieorchester ist schon ein komisches Tier. Da spielen 50 bis 100 Menschen auf mehr als einem Dutzend verschiedener Instrumente, aus Holz, aus Blech, mit und ohne Saiten, in einem großen Saal mitten in der Stadt, der genau für diesen Zweck gebaut wurde. Nach einem Jahr Entzug reibt man sich Augen und Ohren, und fragt sich, wie so etwas überhaupt funktionieren kann. Der Aufwand, das Proben, die Vorbereitung sind jedes Mal aufs Neue logistische Herausforderungen, für die es Strukturen und Routinen braucht. Um den Aufwand überhaupt zu rechtfertigen, bedarf es an diesem Abend auch des Deutschlandfunks Kultur, der das Konzert der Dresdner Philharmoniker “fast live” im Rundfunk überträgt.

Die an diesem Abend musizierte Trias tschechischer Sinfonik wird dabei symbolträchtig zu einer Umkehr von Haydns Abschiedssinfonie. Schrittweise wächst die Anzahl der Musiker von Stück zu Stück. Erst sind es nur die Hörner und Blechbläser, diese machen Platz für die Streicher, bevor dann alle vereint mit den Holzbläsern für Antonin Dvořáks Sechste Sinfonie zusammen kommen. Neben dem Dirigenten Tomáš Netopil ist allein der Pauker Oliver Mills für alle drei Kompositionen im virtuosen Einsatz. Der Weg über die einzelnen Klangregister bis hin zur vollen Besetzung erlaubt so den entwöhnten Ohren auch eine behutsame Wiederannäherung an den Orchesterklang.
Eine Radioübertragung ohne Publikum erlaubt dabei einige ungeahnte Freiheiten. Das Orchester darf die Pinguinkostüme im Schrank lassen, stattdessen blinken uns farbige Kleider an. Ganz nach Lust, Laune und Geschmack, trägt man ein elegant gemustertes Hemd oder T-Shirt, Ringelpullover und Jeans oder einen frech gepunkteten Rock, Lederschuhe in allen Farben oder modische Turnschuhe. In den Umbaupausen scherzen Musikerinnen mit den Technikern, die bei den wechselnden Besetzungen nebenbei ein ganzes Stuhlballett organisieren müssen. Netopil plaudert entspannt mit den ersten Geigen und Pianist und Cellist necken sich beim Einspielen mit musikalischen Imitationen. Allseits heitere Atmosphäre, zufrieden jauchzet groß und klein.
Diese Stimmung überträgt sich mühelos auf die Musik. Den Abend eröffnet eine wahre Entdeckung. Zum ersten Mal überhaupt spielen die Philharmoniker Miloslav Kabeláčs 3. Sinfonie. Ausschließlich für Orgel, Hörner, Blechbläser und Pauken komponiert, öffnet diese Komposition aus dem Jahre 1957 eine Tür zu einem unbekannten, musikalischen Land, eine Tapetentür, hinter der sich eine alternative Musikgeschichte versteckt. Liegt es an der eigenwilligen Besetzung oder der originellen Klangsprache? Alles klingt auf magische Weise vertraut und doch auch verzückend fremd. Manchmal erinnert der Blechklang für einen halben Takt an Filmmusik, oder Bruckner, oder Strawinsky, nur um sofort danach wieder einen Haken zu schlagen. Ein wenig fühlt sich dies an wie ein musikalischer Rorschachtest, der einem zum freien Assoziieren einlädt. Cameron Carpenters virtuoses Orgelspiel verschmilzt mit den Blechbläsern mühelos, als bildeten sie eine gemeinsame Überorgel. Auch hier immer wieder die kleinen Verwechslungsspiele, die beglückende Orientierungslosigkeit bei der Frage, woher ein Klang gerade kommt. Knattern die Hörner? Sind das gedämpfte Trompeten oder gedackte Pfeifen? Dem Ohr eilt da das Auge zu Hilfe. Warum dieses atemberaubende Stück kein vielgespielter Klassiker des 20. Jahrhunderts ist, bleibt ein Rätsel.

Mit Bohuslav Martinůs Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und Pauken H271 steht nach Strauss‘ »Metamorphosen« bereits die zweite von Paul Sacher in Auftrag gegebene Komposition auf den Pulten der Philharmoniker. Der solistisch wie auch kammermusikalisch breit aufgestellte österreichische Pianist Christoph Berner entpuppt sich als kongenialer Partner für die Streicher der Philharmoniker. Wie bei Kabeláč geht es hier nicht um den Starsolistenpart der Virtuosenliteratur des 19. Jahrhunderts, sondern um ein Mischen und Kontrastieren von Klangfarben, um ein gleichberechtigtes Musizieren, um das Zusammenklingen, also um das Symphonische im Wortsinne.
Mit Dvořák nähren sich die Philharmoniker und Netopil dann schließlich noch der Herzkammer der sinfonischen Gattung, dem 19. Jahrhundert. Wie eine Horde Teenager stürzen sie sich gemeinsam ins wild tanzende Treiben der 6. Sinfonie. Ein kollektives Grinsen macht sich breit. Hier herrscht so viel mitreißender Überschwang, dass es nur allzu verständlich ist, wenn es hier und da mal etwas wackelt, etwas gurkt, und die Intonation beim genauen Hinhören vielleicht nicht standhält. Alles unwichtig! Dies ist kein bürgerlicher Osterspaziergang im Sonntagskleid, dies ist ein bacchantisches Fest. Die Philharmoniker spielen, als feierten sie die Auferstehung des Herrn, der Sinfonik. Denn sie sind selber auferstanden.